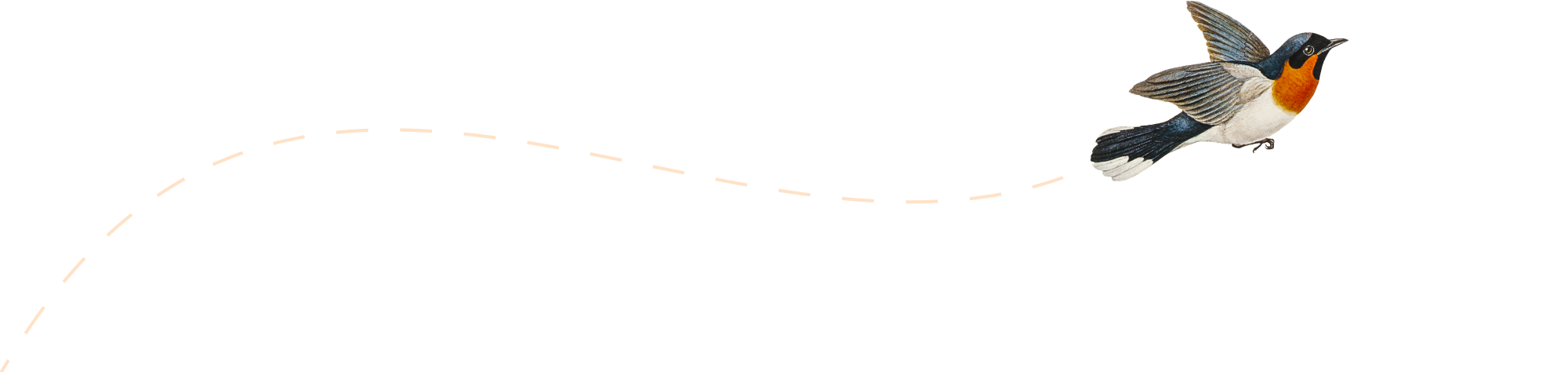-
The Biggest Threat to Cyber-Security is Surveillance
The biggest threat to cyber-security is surveillance. Or rather the will, ability and legal status of organisations who prioritise surveillance and active attack abilities above defence and security.
-
On Ebooks and pricing
There is a „sweet price“ for ebooks, where people will just buy them, regardless of whether they already read or have them on paper or even expect to find the time to read them.
-
On Ebooks and pricing
There is a „sweet price“ for ebooks, where people will just buy them, regardless of whether they already read or have them on paper or even expect to find the time to read them.
-
Swisscom Peering Policy Perversions
Die Swisscom verlangt monatlich Geld fürs Peering. Das kann sie nur unter Missbrauch Ihrer Marktmacht.
-
Swisscom Peering Policy Perversions
Die Swisscom verlangt monatlich Geld fürs Peering. Das kann sie nur unter Missbrauch Ihrer Marktmacht.
-
Die Überwachung und der Skandal
Wir haben einen Skandal, aber der ist nicht dass die NSA alles abhört, sondern dass sie dabei von Kollaborateuren in unseren Ländern unterstützt wird, und dass unsere eigenen Regierungen nichts dagegen unternehmen.
-
Die Überwachung und der Skandal
Wir haben einen Skandal, aber der ist nicht dass die NSA alles abhört, sondern dass sie dabei von Kollaborateuren in unseren Ländern unterstützt wird, und dass unsere eigenen Regierungen nichts dagegen unternehmen.
-
Closed Data
Was ist eigentlich das Gegenteil von „Open Data“, und was sind die Hintergründe weshalb nicht grundsätzlich schon alles „Open Data“ ist?
-
Closed Data
Was ist eigentlich das Gegenteil von „Open Data“, und was sind die Hintergründe weshalb nicht grundsätzlich schon alles „Open Data“ ist?
-
Patents on Bronze Age Technology
Apple managed to get a patent on an invention which dates at least from 1290 B.C.